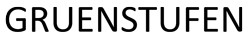Wusstet ihr, dass Pfauen Schlangen fressen, trotz ihres Federschweifs fliegen können, und sie ihre Pfauenaugen der Ermordung des Ungeheuers Argos verdanken?
Jede Menge Pfauenfedern
Dem aufmerksamen Betrachter wird aufgefallen sein, dass für eines der Fine-Art-Fotos (Abb. 1) eine exorbitant hohe Zahl an Pfauenfedern zum Einsatz gekommen ist. Diese Aufnahme sei zum Anlass genommen, hier einen Blick hinter die Feder zu werfen. Natürlich wurde kein Pfau gerupft – Vögel erneuern im Zuge der Mauser ihr Federkleid, und dementsprechend kommen übers Jahr reichlich Federn zusammen.
Welche Pfauenarten gibt es?

Abb. 2: Grüner Pfau/Ährenträgerpfau (Pavo muticus). Foto: Dr. Raju Kasambe, CC BY-SA 4.0
Neben der eingangs vertretenen Pfauenart, dem Blauen Pfau (Pavo cristatus) aus der Gattung der asiatischen Pfauen (Pavo), gibt es Ährenträgerpfauen (Pavo muticus, auch: ‚Grüner Pfau‘, Abb. 2), Kongopfauen (Afropavo congensis, Abb. 3) und verschiedene Mutationen und Kreuzungen. Wer schon einmal nähere Bekanntschaft mit Pfauen gemacht hat, wird vielleicht auf den Gedanken gekommen sein, es handele sich doch eigentlich nur um große, bunte Hühner. Dies liegt gar nicht so fern: Der Pfau stammt aus der Familie der Fasanenartigen (Phasianidae), welche wiederum der Ordnung Hühnervögel (Galliformes) angehört. Bei den Römern fanden sie eine ähnliche Verwendung: als Braten. Letzteres ist auch heutzutage einer von mehreren Gründen, weshalb der Ährenträgerpfau vom Aussterben bedroht ist.
Die Pfauenarten im Überblick
- Blauer Pfau (Pavo cristatus)
- Ährenträgerpfau (Pavo muticus, auch: ‚Grüner Pfau‘)
- Kongopfau (Afropavo congensis)
- Mutationen und Kreuzungen
Woher kommt der Pfau, und wie lebt er?

Abb. 3: Kongopfau (Afropavo congensis). Foto: Frank Wouters, CC BY 2.0
Pfauen stammen ursprünglich aus dem indischen Raum. Sie leben im Schutz dichter Wälder, die sie bei Einbruch der Dämmerung verlassen, um auf Wiesen und Feldern nach Nahrung zu suchen. Dieser Kontext verdeutlicht, dass ihre grün-blau-metallischen Federn nicht per se von Nachteil sind, da sie sich farblich in ihre Umgebung einpassen, einschließlich Blau, das bei abnehmender Helligkeit schnell an Kontrast und Leuchtkraft verliert. Einige Pfauenarten sind besonders standorttreu, und zudem kälteresistent – daher werden sie inzwischen weltweit gehalten. Da neben Pflanzlichem auch Schlangen zur Nahrung des Blauen Pfaus gehören, ist er in seinem Ursprungsland sehr beliebt.
Bei der Ansiedlung eines Pfauenpaares kann dieses auf einfachem Wege an den neuen Lebensraum als festen Standort gewöhnt werden, ein angemessen großes Grundstück vorausgesetzt, wodurch die Tiere nicht in Gefangenschaft leben müssen (Heitmann, 2017). Sie leben im Familienverband und können mit anderen Tieren ein Bauernhofidyll-typisches Nebeneinander bilden (Abb. 4), wobei die schiere Menge Vogel – ca. 2 — 6,5 kg, bei, Federn eingerechnet, einer Länge von bis zu 2 m – und entsprechende Schnabelstärke sicherlich hilfreich sind, seitens Vertretern der Felinae mit Respekt behandelt und nicht als potenzielles Futter betrachtet zu werden. Eine Großkatze hingegen wäre ihr natürlicher Feind.
Wie sich der Pfau verteidigt

Abb. 5: Radschlagender, Blauer Pfau im Ranthambhore Tiger Reserve. Foto: Koshy Koshy, CC BY 2.0
Kommt es zu einer Bedrohung durch einen Feind, steht der Pfau diesem nicht hilflos gegenüber. Trotz seiner zahlreichen langen Federn – bis zu 150 Stück – kann er fliegen und schnell rennen. Ist kein Gebüsch in Reichweite, würde der nächste höher gelegene Ast zur Zuflucht, wobei eine gewisse Voraussicht notwendig ist, denn für den Take-off werden einige Meter Anlaufbahn benötigt. Die Schwanzfedern kann der Pfau auch defensiv einsetzen: Zum Rad aufgeschlagen, können sie auf das bedrohende Tier einen irritierenden oder furchterregenden Eindruck machen, da die Illusion einer übermächtigen Zahl großer, starrender Augen erweckt wird (Abb. 5. Vergleiche auch: Schmetterlingsart ‚Pfauenauge‘). Werden die Federn in dieser Position in hoher Frequenz bewegt, entsteht ein rasselndes Geräusch, das die Wirkung verstärkt.
Das Rad des Pfaus

Abb. 6: Pfauenhenne, Parsonage Farm, New Forest. Foto: Jim Champion, CC BY-SA 2.0
Der fast gegenteilige Effekt kommt während der Balz zum Tragen, wenn die Aufmerksamkeit paarungsbereiter Weibchen erregt werden soll. Auch hier werden die Schwanzfedern zum Rad aufgeschlagen und in rasselnde Schwingungen versetzt. Dakin et al. (2016) haben in einer ausführlichen Studie mit Hilfe von Mikrofonen und Hochgeschwindigkeitskameras untersucht, wie genau die dynamischen Effekte der Federbewegungen beschaffen sind und in welchem Zusammenhang sie mit der Attraktivität des Pfauenhahns gegenüber Weibchen stehen. Durch den leicht variierenden Aufbau der Feder wird diese einerseits in die nötige Schwingung versetzt, bewahrt das prächtige Pfauenauge aber zugleich in einer Ruheposition. Die Frequenz liegt bei etwa 25 Hz – das ist ein niedriger Schwingungsbereich, den beispielsweise gute Lautsprecher im Tiefbassbereich gerade noch wiedergeben. Hier gibt es eine Parallele, die HiFi-Enthusiasten und Lautsprecherbauern bekannt vorkommen wird: Der Pfau nutzt bei der Federbewegung eine Eigenresonanz der Federn, wodurch er bereits mit wenig Energieaufwand den nötigen Bewegungseffekt erreicht. Auf diesem Prinzip beruhen Bassreflexboxen (wer mit dieser Thematik nicht vertraut ist, kennt vielleicht trotzdem den Effekt, der sich beobachten lässt, wenn ein Stahlseil oder eine Brücke durch schwache, aber gleichmäßige Impulse in starke Schwingungen versetzt wird). Da dieser Akt bis zu 25 Minuten andauern kann, was dann doch einen gewissen Kraftaufwand erfordert, gibt er Weibchen (Abb. 6) womöglich Auskunft über Fitness und Stärke des Männchens.
Wie konnten Pfauen mit diesem Handicap überleben?
Einen Erklärungsansatz, weshalb es den Pfau im heutigen, schillernden Erscheinungsbild überhaupt gibt, liefert das Handicap-Prinzip. Diese Theorie besagt, dass Merkmale (in diesem Fall: optische), die Verschwendung und Nachteil bedeuten können, potenziellen Partnern signalisieren, dass der Aussender von besonderer Überlebensfähigkeit ist, da er trotz dieser Handicaps überlebt hat, und das wiederum steigert seine Attraktivität als Partner. Ein ähnlicher Mechanismus kann sogar bei Menschen beobachtet werden, die zum Zwecke gesellschaftlichen Status‘ augenscheinlich viele Ressourcen in Autos, Uhren, oder Luxuskleidung fließen lassen. Auch hier signalisiert das paarungswillige Männchen, dass es trotz offensichtlicher Verschwendung in der Lage ist, zu überleben, was auf manche Weibchen besonders attraktiv wirkt.
Pfauen in Religion und Mythologie

Abb. 7: Melek Taus. Foto: YZD, CC BY-SA 3.0
Pfauen kommen in verschiedensten Religionen und Mythologien vor, besonders zahlreich im asiatischen Raum (Aberle, n.d.). Oft wird der Pfau mit Reinheit, Schönheit, Leidenschaft, Magie, der Seele, und positiven Kräften in Verbindung gebracht, und tritt als Königs- und Göttergefährte auf. So erschuf im Glauben der Jesiden (vgl.: Mishefa Reş) Gott aus seinen kostbarsten Substanzen eine Perle, und daneben den Vogel Angar, auf dessen Rücken er die Perle ablegte, und auf der er 50.000 Jahre lang hauste. Er schuf sieben Erzengel: Am ersten Tag, dem Sonntag, Melek Anzazîl, der der Engel Pfau, Ṭâ’ûs-Melek (dt.: ‚Melek Taus‘) ist, welcher ihnen vorsteht, und welchem in der weiteren Schöpfungsgeschichte verschiedene Auftritte zukommen (Abb. 7).
Der Pfau und die Königin der Gifte
Pfauen sind immun gegen das Gift der Kobra (Naja) und können Blauen Eisenhut (Aconitum ferox, auch: ‚Wolfsbann‘ oder ‚Königin der Gifte‘) fressen – beide für Menschen tödlich – und symbolisieren daher im Buddhismus, wo die Schlange für potenziell ebenso tödliche Emotionen wie Ärger steht, den Sieg über negative, vergiftende Einflüsse (Khandro, n.d.). Ein Standardwerk des tibetanischen Mentaltrainings (‚Lojong‘), im 9.Jh. verfasst von Dharmarakshita, heißt dementsprechend ‚Pfau in der Schlangengrube‘.
Zeus, Hera und Argos – die Sage um das Pfauenauge

Abb. 8: Zeus-Statue in der Eremitage. Foto: George Shuklin, CC BY-SA 3.0
In der griechischen Mythologie handeln viele Kapitel von den verstrickten Beziehungen verschiedener Götter, Halbgötter und Wesenheiten zueinander, und deren teils verheerenden Folgen. Merkelbach (2001) beschreibt in „Isis Regina – Zeus Sarapis“ ausführlich eine der verhängnisvolleren Ausschweifungen des Göttervaters Zeus: So begab es sich in der Stadt Argos, dass Zeus (Abb. 8), der oberste olympische Gott, von Hera, nicht nur Wächterin der Ehe, sondern auch Gattin und Schwester, um Haaresbreite bei ausgiebigen Umtrieben mit einer ihrer Priesterinnen, der Nymphe Io, überrascht wurde. Zwar konnte er Io rechtzeitig in ein junges Rind verwandeln, musste dieses aber, um sich nicht zu verraten, Hera überlassen. Sie wollte es nun als Geschenk verwenden und beauftragte den tausendäugigen Hirten Argos mit der Beaufsichtigung. Zeus, dem dies missfiel, bat seinen Sohn Hermes um Hilfe. Dieser schläferte Argos mit einer langatmigen Erzählung über die Bewandtnis seiner Hirtenflöte (die seines Sohnes Pan) ein, woraufhin er die Gelegenheit nutzte und ihm den Kopf abschlug. Hera verwandelte den Hirten aus Mitleid in den Argus-Pfau, wo sich seine Augen als Pfauenaugen auf den zahlreichen Schwanzfedern wiederfinden.
Der urzeitliche Stammbaum des Pfaus

Abb. 9: Urvogel „Archaeopteryx“, Lithographie des Originals des Natural History Museum in London. Foto: gemeinfrei
Zeitlich bedeutend weiter reicht der Stammbaum der Vogelartigen zurück, dessen tiefste Wurzeln vor etwa 200 Millionen Jahren im Erdzeitalter Jura beginnen. Vielen ist der fossil erhaltene Urvogel „Archaeopteryx“ bekannt (Abb. 9), dessen Ursprünge im Oberjura vor etwa 145 Millionen Jahren liegen. Dem Jura entstammt übrigens auch der unter Sammlern wie Nicht-Sammlern beliebte Ammonit (Abb. 10).
Eine einfache Gegenüberstellung (Abb. 11 und 12) verdeutlicht die Verwandtschaftsverhältnisse. Es war dem Fotografen sehr willkommen, den Tieren bloß in ihrer heutigen Größe gegenübergestanden zu haben. Die Darstellung der hier abgebildeten Saurier geht nur bedingt auf künstlerische Freiheit zurück: Verschiedene Saurierarten trugen tatsächlich ein Federkleid. Ihr genaues Erscheinungsbild ist derzeit noch nicht benennbar, jedoch haben neue Fundstücke und Untersuchungsmethoden dazu beigetragen, ein präziseres Bild dieser urzeitlichen Lebensformen zu erhalten.

Abb. 12: Dromaeosauridae (V.l.n.r.: Microraptor gui, Velociraptor mongoliensis, Austroraptor cabazai, Dromaeosaurus albertensis, Utahraptor ostrommaysorum, Deinonychus antirrhopus). Grafik: Fred Wierum, CC BY-SA 4.0
Um den Kreis an dieser Stelle zu schließen, sei erwähnt, dass ein Pfauenfederkiel ein außerordentlich extravagantes Schreibgerät abgibt…
Quellen
Aberle, T. (n.d.). Der Pfau als Symbol in Asien. Asienhaus. URL: https://www.asienhaus.de/public/archiv/symbolpfau.pdf. Abgerufen am: 15.10.2019
Dakin, R. / McCrossan, O. / Hare, J. / Montgomerie, R. / Kane S. (2016, April 27). Biomechanics of the Peacock’s Display: How Feather Structure and Resonance Influence Multimodal Signaling. PLoS ONE 11(4): e0152759. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152759
Heitmann, J. (2017, November 30). Pfauen halten [Blog post]. Kleinod-Farm. URL: https://www.kleinod-farm.de/pfauen-halten. Abgerufen am 15.10.2019
Khandro (n.d.). Peacock [Blog post]. URL: http://www.khandro.net/animal_bird_peacock.htm. Abgerufen am: 04.01.2020
Merkelbach, R. (2001). Isis Regina — Zeus Sarapis: Die griechisch-ägyptische Religion nach den Quellen dargestellt, 2., verb. Auflage, München/Leipzig, Deutschland: K. G. Saur, S. 68.
Mishefa Reş. Wikisource. URL: https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Mishefa_Re%C5%9F&oldid=6651882. Abgerufen am: 15.10.2019
Impressionen